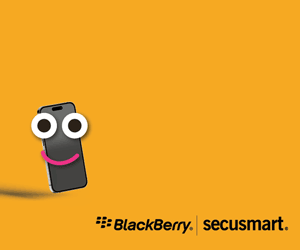Die Extremwetterlagen und damit einhergehenden Flutkatastrophen häufen sich – zuletzt erst in Südwest- und Süddeutschland. Zwar ist die akute Gefahr durch erhöhte Wasserstände abgeklungen, doch die Aufräumarbeiten im Saarland, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern sind in vollem Gange. Das alles lässt sich auf den Klimawandel zurückführen und führt nicht nur zu mehr Katastrophenlagen dieser Art, sondern auch zu einem neuen „Normal“, ist Daniela Jacob, Leiterin des Climate Service Center Germany, überzeugt. „Wir müssen Klima-Resilienz zum Mainstream machen“, erklärt die Klimaforscherin, „und wir müssen den Klimawandel dringend stoppen, bevor es noch wärmer wird.“
Doch viele Experten auf dem „European Civil Protection Forum 2024“ sind sich einig: Um diese Stufe des Zivil- und Katastrophenschutzes zu erreichen, muss an zwei wichtigen Stellschrauben gedreht werden: Punkt eins ist die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den direkt benachbarten Akteuren im Katastrophenschutz (auf allen Ebenen). Zwar sei das Katastrophenschutzverfahren der EU (UCPM) eine gute Sache, doch die meisten Katastrophen haben einen zeitkritischen Faktor, bei der das UCPM zu langsam reagiere und in akuten Notsituationen nicht helfen könne, kritisiert Zsolt Kelemen vom Budapester Feuerwehrverband, EU-Strategie für den Donauraum, Arbeitsgruppe „Umweltrisiken – Schwerpunktbereich Katastrophenmanagement“. Für ihn ist es daher besonders wichtig, mit den nächsten Nachbarn zusammenzuarbeiten. Ob nun regional oder von benachbarten Ländern, beides sei sehr wichtig, um in zeitkritischen Lagen schnell und effektiv zu handeln. Das es dafür aber auch entsprechendes Training und Wissen braucht, verdeutlicht Marie Sattler, zuständig für Internationale Beziehungen vom Großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungskorps Luxemburg (CGDIS): Laut ihrer Aussage habe Frankreich ein anderes Anschlusssystem für Feuerwehrschläuche an Hydranten, als sie in Deutschland oder Belgien üblich sind. Überregionale Einsatzkräfte müssen über solche Unterschiede und Ähnliches aufgeklärt sein, um effektiv zusammenarbeiten zu können.
Hinzu käme außerdem, dass die nächstgrößere Instanz – wie etwa der Staat – sich häufig mit vielen unterschiedlichen Problemen auseinandersetzen müsse. Da sei eine Katastrophe nach ca. drei Monaten schon durch das nächste Problem verdrängt, erklärt Nejc Smole, Bürgermeister der Gemeinde Medvode und stellvertretender Präsident der Region Mittelslowenien. Doch die betroffenen Regionen, die natürlich auch deutlich länger mit dem Wiederaufbau und Reparaturen beschäftigt seien, würden sich deutlich länger erinnern und wüssten auch, wo es besonders problematisch gewesen sei. Daher solle man gerade auf die betroffenen Regionen hören.
Vertrauen ist gut, Selbsthilfe ist besser
Punkt zwei ist das Vertrauen und die Mitarbeit der Bevölkerung zu stärken. Doch um die Menschen mitzunehmen und sie zur Mithilfe und zum Selbstschutz zu befähigen, müsse man transparent und offen über die Möglichkeiten, Limits und Risiken sprechen, meint Raed Arafat, Staatssekretär im Ministerium für innere Angelegenheiten von Rumänien. Durch die Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus dem Krisenmanagementbereich könne man anstelle von Panik und Krisenmüdigkeit ein Krisenbewusstsein schaffen, ist der Staatssekretär überzeugt.
Eine ähnliche Ansicht vertritt Agnė Bilotaitė, Innenministerin der Republik Litauen. Die Bevölkerung müsse auf möglichst viele verschiedene Lagen vorbereitet sein und wissen, wie man sich in diesen Lagen zu verhalten habe. „Erwarte das Beste, sei auf das Schlimmste vorbereitet“, ist ihre Devise. Und diese Vorbereitung sollte so früh wie möglich anfangen. Früher seien auch Kinder schon im Umgang mit Extremsituationen geschult worden, wohingegen Europa heute, wo es unter größerer Bedrohungslage als noch Jahre zuvor stehe, schlechter vorbereitet sei, als noch zu Zeiten des Berliner Mauerfalls, erklärt der europäische Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarčič.
Doch wie gewinnt man das Vertrauen der Menschen? Kati Orru, Professorin für Soziologie der Nachhaltigkeit an der Universität Tartu, ist der Ansicht, dass gerade sozialbenachteiligte Menschen, wie beispielsweise Obdachlose, dem Staat und dessen Schutzmaßnahmen skeptisch gegenüberstünden. Dem könne man nur entgegensteuern, indem man auch diesen Teil der Bevölkerung integriere und sozialisiere. Außerdem müssten sich die Menschen besonders in Entscheidungsprozesse eingebunden fühlen, damit sie sich gehört und verstanden fühlten, ergänzt Raffaella Russo, Leitende Projektmanagerin an der Universität von Salerno (UNISA). Dies sollte man auch schon vor dem Eintreffen einer Katastrophe tun, denn es handele sich dabei um einen langen Prozess und der Aufbau von Vertrauen lasse sich nicht während einer bestehenden Katastrophe bewerkstelligen.