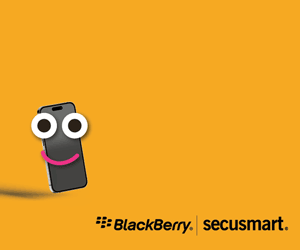Pöbeleien, Beleidigungen, Attacken mit Steinen, sexuelle Übergriffe: Nicht nur Politiker sind zunehmend von gewalttätigen Attacken betroffen, auch im Öffentlichen Dienst häufen sich die Vorfälle. Doch was hilft?
Anfang Mai wurde der sächsische SPD-Politiker Matthias Ecke beim Aufhängen von Wahlplakaten attackiert und schwer verletzt. Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey war bei einem Bibliotheksbesuch einem Angriff ausgesetzt. Und in Essen wurden die beiden Grünen-Politiker Kai Gehring und Rolf Fliß attackiert. Vorfälle von gewalttätigen Übergriffen gegen Politiker haben in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen bestimmt – dabei zeigt sich die zunehmende Gewaltbereitschaft aber nicht nur gegenüber politischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Auch Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes sind immer häufiger von Übergriffen betroffen. Dabei stellt sich die Frage, mit welchen Maßnahmen sich den gewaltbereiten und aggressiven Tendenzen entgegenwirken lässt?
Gewaltprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Für Andreas Hemsing, den stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes und Tarifunion, ist Gewaltprävention für den Öffentlichen Dienst eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dabei sei die aktuelle Situation besorgniserregend: In Deutschland vergehe kein Tag ohne Angriff auf Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes, erklärte Hemsing auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin.
So seien 23 Prozent der Beschäftigten während ihrer Tätigkeit bereits einmal bedroht, belästigt oder beleidigt worden oder sexueller Gewalt ausgesetzt gewesen – doch nur 30 Prozent der Betroffenen hätten die Vorfälle am Ende gemeldet. Die hohe Dunkelziffer habe auch damit zu tun, dass „Meldungen in einigen Dienststellen nicht so gern gesehen“ seien, sagte Hemsing und machte damit auf eine folgenschwere Schwachstelle in puncto Aufklärung der Vorfälle aufmerksam.
Aus Sicht der Gewerkschaft sei es daher wichtig, dass zunächst einmal das Bewusstsein für derartige Attacken und Übergriffe geschärft werde. Der stellvertretende Vorsitzende des Beamtenbundes fordert deshalb: Deeskalationsschulungen müssten selbstverständlicher werden, auch solle es „regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen für gefährdete Beschäftigte“ geben.
Gefährdungsbeurteilungen als „lästige Pflicht“
Michael Stock, Geschäftsführer der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, konkretisierte die Vorfälle von Gewalt. So kämen nicht nur Beschimpfungen oder Beleidigungen vor, es würden bisweilen auch Gegenstände, wie Steine, Scheren oder Tacker geworfen. „Prävention funktioniert nur dann, wenn die Beschäftigten für das Thema sensibilisiert werden und sie auch den Mut aufbringen, ihre Vorgesetzten zu informieren“, sagt auch er. Nach der Erfahrung des Hamburger Polizeipräsidenten Falk Schnabel seien allerdings eben diese Gefährdungsbeurteilungen für viele Vorgesetzte eine „lästige Pflicht“.
Übergriffe auf Behördenbeschäftigte ereignen sich häufig auch aufgrund von Wartezeiten. „Es kommt immer wieder vor, dass Menschen der Ansicht sind, mit Hilfe von Gewalt hier eine Verkürzung herbeizuführen zu können“, berichtet Prof. Dr. Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
„Wenn Beschäftigte im Öffentlichen Dienst Opfer von Gewalttaten werden, sind sie in dem Moment nicht das Individuum, sondern Repräsentant des Staates“, erklärt Manuela Söller-Winkler, Landesvorsitzende Schleswig-Holstein bei der Hilfsorganisation Weißer Ring. Das mache die gesamte Thematik noch einmal unberechenbarer als „Hasskriminalität, die sich gegen bestimmte Gruppen richtet“, unterstrich sie.