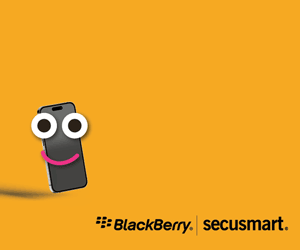Angesichts des Ukraine-Krieges und der allgemeinen Verschlechterung der sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen haben die baltischen Staaten sowie die nordischen Länder den Wehrdienst in unterschiedlichen Ausprägungen wieder eingeführt, nachdem die allgemeine Wehrpflicht infolge des Falls der Berliner Mauer in fast allen europäischen Staaten abgeschafft oder ausgesetzt wurde.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seine Überzeugung, dass Deutschland eine Art der Wehrpflicht benötigt, wiederholt geäußert und damit die Diskussion über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland angestoßen. Für eine Umsetzung müssen zunächst aber auf mehreren Ebenen die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden. In Deutschland zeichnet sich für ein Wiedereinsetzen der alten Wehrpflicht allein schon innerhalb der Regierung keine politische Mehrheit ab. Nach Auffassung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird es einen „Wehrdienst wie früher“ nicht wieder geben. Die Bewältigung des Personalmangels bei der Bundeswehr sei eine „überschaubare“ Aufgabe. Tatsächlich aber ist statt der angestrebten Erhöhung des militärischen Personalumfangs auf 203.000 die Zahl real auf 181.500 gesunken und nach der Bewertung des Verteidigungsministeriums ist es auch mit einem optimierten Status Quo wenig erfolgversprechend, diese Entwicklung umzudrehen, da zu wenig Bewerber erreicht werden können, um den Bedarf von bis zu 40.000 Soldaten zu decken.
In keiner der drei Regierungsparteien scheint ein übergreifender Konsens zur Unterstützung des Verteidigungsministers bei diesem Thema erzielbar zu sein. Die Sprecherin für Sicherheitspolitik in der Grünen-Fraktion, Sara Nanni, sprach zwar von einer „notwendigen Diskussion um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes“, die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripur sehen aber derzeit keine schlüssige Begründung für eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Diese Auffassung wird auch von der FDP geteilt, deren verteidigungspolitischer Sprecher Alexander Müller kürzlich äußerte, „dass der Entzug der Freiheit junger Menschen sehr gut begründet werden muss, und eine solch bedrohliche Lage haben wir absehbar nicht“.
Anders stellt sich die Situation bei der CDU dar, die auf dem letzten Parteitag die schrittweise Rückkehr zur Wehrpflicht verabschiedete, welche dann in ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr überführt werden soll. Ein konkretes Modell, das Frauen und Männer gleichbehandelt, wird derzeit erarbeitet.
Die AfD ist ebenfalls der Auffassung, dass die Wehrpflicht ernsthaft diskutiert werden müsse – am besten mit der Rückkehr zu dem ehemaligen System, da dies aus Sicht der AfD am einfachsten und am schnellsten umsetzbar sei.
Rechtliche Aspekte
Aus rechtlicher Sicht wäre die Wiedereinführung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht tatsächlich mit einfacher Mehrheit des Parlaments erreichbar. Jedoch würden damit nur Männer erfasst werden, da Artikel 12a des Grundgesetzes die Wehrpflicht ausdrücklich nur für Männer vorsieht. Aspekte der Freiwilligkeit, der Wehrgerechtigkeit sowie der Gleichbehandlung von Männern und Frauen blieben nur unzureichend berücksichtigt. Diese sind aber wesentliche Bestandteile der politischen Diskussion über die Verteidigungsfähigkeit und Resilienz Deutschlands, sodass hier bestenfalls ein politischer Konsens über die Wiedereinführung als Zwischenschritt hin zu einer allgemeinen Dienstpflicht oder einem Gesellschaftsjahr erreichbar wäre. Ein solches würde wiederum ein Bündel an Änderungen im Grundgesetz erfordern, welches nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit des Parlaments durchsetzbar wäre und absehbar langwierige Diskussionen mit sich brächte – Zeit, die wir nicht haben.
Gesellschaftlicher Konsens
Nach einer im Februar vom NDR durchgeführten Meinungsumfrage sind 58 Prozent der Befragten für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland, 33 Prozent sind dagegen. Allerdings haben nur etwa 30 Prozent der Befragten unter 30 Jahren signalisiert, dass sie auch bereit wären, Wehrdienst zu leisten. Ein weiteres Ergebnis dieser Umfrage: Mehr als 70 Prozent der Befragten sind dafür, dass auch Frauen Wehrdienst leisten sollten. Eine einfache Wiedereinsetzung der Wehrpflicht nur für Männer würde damit eher nicht von einem gesellschaftlichen Konsens getragen werden; ein verpflichtender Dienst müsste zumindest auch auf andere Bereiche wie den Zivil- und Katastrophenschutz sowie die sozialen Bereiche ausgedehnt werden. Gerade aus den letztgenannten Bereichen kommen jedoch trotz der angespannten personellen Situation eher skeptische Signale, welche sich insbesondere auf die Kosten und den administrativen Aufwand beziehen, die eine Aufnahme von hunderttausenden Pflichtdienstleistenden mit sich brächte.
Auch seitens der Wirtschaft wird die Wehrpflicht eher kritisch gesehen, da die temporäre Nichtverfügbarkeit von potenziellen Bewerbern die jetzt schon schwierige Situation bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen mit geeigneten Bewerbern weiter verschärfen würde.
Bundeswehrinterne Maßnahmen
Eine allgemeine Wehrpflicht würde mehr Menschen in Kontakt mit der Bundeswehr bringen und – wie die Zeit bis 2011 gezeigt hat – das Interesse junger Menschen für den längerfristigen Dienst in den Streitkräften deutlich erhöhen. Über diesen Weg könnte eine in Bezug auf Umfang und Altersstruktur angemessene Reserve aufgebaut werden. Für die damit einhergehende signifikante Erhöhung des Streitkräfteumfangs müssten aber zunächst die logistischen und organisatorischen Voraussetzungen in Form einer reibungslos funktionierenden Erfassung, Musterung und Aufnahme, einer guten persönlichen Ausrüstung, einer fundierten Ausbildung an modernem Gerät sowie einer angemessenen Unterbringung geschaffen werden.
Hierauf ist die Bundeswehr gegenwärtig nicht vorbereitet und das Schaffen der genannten Voraussetzungen würde neben erheblichen zusätzlichen finanziellen Mitteln vor allem auch Zeit für die Umsetzung benötigen. Die für die Musterung zuständigen Kreiswehrersatzämter wurden 2011 geschlossen und ein großer Teil der ehemals vorhandenen Immobilien wurde für andere Zwecke freigegeben. Selbst die Aktivierung noch vorhandener, nicht mehr aktiv genutzter Infrastruktur dürfte erhebliche Mittel verschlingen. Gleiches gilt für die Beschaffung zusätzlicher persönlicher Ausrüstung und moderner Waffensysteme. Die Ausbildungsorganisation müsste ebenfalls signifikant erhöht werden, um die gestiegene Zahl an Kurzzeitdienenden zielführend ausbilden zu können. Voraussetzung hierfür wäen neben Ausbildern auch zusätzliche Ausbildungsmittel und -einrichtungen. Eine ernstgemeinte Zeitenwende braucht ernsthaftes Engagement und signifikante Mittelerhöhungen auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen – zumindest der Bundesverteidigungsminister hat dies erkannt.