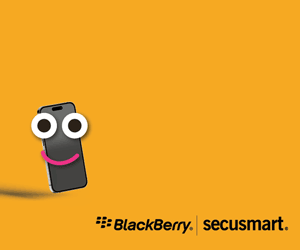Wie können öffentliche Auftraggeber im Vorfeld einer Vergabe Zeit einsparen und damit den Vergabeprozess insgesamt beschleunigen? Dieses Thema diskutierten renommierte Fachleute aus den Bereichen Bundeswehr, Wissenschaft und Industrie auf dem Defence Procurement Day in Bonn.
Zeit ist heute ein kritischer Faktor für den Fähigkeitsaufbau der Bundeswehr, erläuterte der Abteilungsleiter Planung im Bundesministerium der Verteidigung, Generalleutnant Gert Friedrich Nultsch auf dem Defence Procurement Day des Behörden Spiegel Anfang Mai. Dabei ginge es nicht nur um den eigentlichen Beschaffungsprozess, sondern auch um den vorgeschalteten Planungsprozess, der – ausgehend von den Planungszielen der NATO über das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr bis hin zur Haushaltsaufstellung und Realisierung – den seit der Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers deutlich gestiegenen Bedarf der Streitkräfte abbildet. Zusätzlich seien neben der nationalen Ausrichtung der Streitkräfte auch die bündnispolitischen Wechselwirkungen sowie die industriellen Kapazitäten und Fähigkeiten zu berücksichtigen, die zusätzliche Komplexität mit sich brächten.
Zeitenwende und Realität aus Sicht des Beschaffers
Der Leiter des Justiziariats des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Matthias Mantey, stellte die wesentlichen Veränderungen seit der Zeitenwende aus der Sicht des Beschaffers dar. So habe der Faktor Zeit gegenwärtig absolute Priorität bei der Beschaffung, was sich in den Zeitvorgaben für die Bearbeitung von Initiativen und von „Fähigkeitslücken und Funktionalen Forderungen mit Lösungsvorschlägen“ widerspiegle. Zwingende Anforderungen würden sich an existierenden technischen Möglichkeiten orientieren und Modifikationen nur noch zugelassen, wenn dies unverzichtbar sei. Sofern es sich nicht um ministeriell festgelegte Entwicklungsprojekte handele, würden grundsätzlich marktverfügbare Lösungen angestrebt. Bundeswehrinterne Vorschriften, die gesetzliche Regelungen verschärfen, wären ausgesetzt, was erhebliche Zeitvorteile mit sich brächte.
Diese Maßnahmen seien im Wesentlichen Ausflüsse aus dem seit Juli 2022 geltenden Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz (BwBBG), welches mit dem Ziel einer schnellen Erhöhung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr erlassen wurde. Instrumente für die Beschleunigung von Vergabeverfahren seien beispielsweise die Vereinfachung europäischer Beschaffungskooperationen und die verstärkte Berücksichtigung von nationalen Sicherheitsinteressen. Allerdings kollidierten diese neuen Regelungen in der Praxis häufig mit den Entscheidungen der Vergabekammern, die weiterhin ein bestimmtes Maß an zusätzlichem Aufwand für zumutbar erachteten. So seien beispielsweise für Nachfolgebeschaffungen mit Produktvorgabe weiterhin detaillierte Beschreibungen der Gründe erforderlich. Insgesamt sei es daher nicht hinreichend, innerhalb der Bundeswehr am Faktor Zeit zu arbeiten, die Zeitenwende müsse vielmehr als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden, zu deren zügiger Abwicklung alle Beteiligten ihren Beitrag leisten müssten.
Strategische Kompetenz in der Beschaffung
Die Beschaffung bestehe nicht nur aus der Vergabe einer Leistung, sondern müsse vielmehr als Lieferkettensteuerung verstanden werden, erläuterte Professor Dr. Michael Eßig von der Universität der Bundeswehr München. Die ersten Schritte seien immer eine Marktanalyse und die Prüfung der Marktverfügbarkeit eines Produkts, weil es die Märkte seien, die uns trieben. In den USA spreche man eher von „Geschwindigkeit“ anstelle von „Zeit“ und der Grundsatz sei, sich an die Geschwindigkeit einer sich ändernden Welt anzupassen, anstatt mit festen Zeitvorgaben zu arbeiten. Dies könne zu Lasten anderer Dinge, wie zum Beispiel Kosten und Qualität, gehen. Die Leistungen seien der Schlüssel, daher seien für unterschiedliche Produkte auch differenzierte Beschaffungsstrategien erforderlich, die wiederum eine gewisse strategische Kompetenz erforderten.
Die Perspektive der Industrie
Einen neuen Blick auf die Veränderungen seit der Zeitenwende vermittelte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Dr. Hans C. Atzpodien, indem er den Fokus auf das, was noch zu verändern ist, anstatt auf das seit der Zeitenwende Erreichte setzte. Zwar attestierte er einige positive Veränderungen in der Beschaffung, aber insgesamt verbleibe noch viel Gestaltungsraum bei der Vereinfachung von Verfahren und Nebenprozessen, wie beispielsweise in den Bereichen der Güteprüfung und der technischen Abnahmen.
Unter Verweis auf die in Frankreich vor zwei Jahren initiierte „Économie de guerre“ erläuterte er die noch verbleibenden systemischen Baustellen der deutschen öffentlichen Vergabeprozesse und die gerade für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie weiterhin bestehenden Risiken. Zwar habe diese bereits in erheblichem Umfang neue Kapazitäten aufgebaut, auch auf eigenes Risiko und ohne Aufträge, aber diese müssten nun durch langfristig belastbare Bestell- und damit Budget-Perspektiven untermauert werden. Mit Blick auf die weiter ansteigende Bedrohungslage und die geforderte „Kriegstüchtigkeit“ müsse Deutschland jetzt in den Modus einer „Resilienzwirtschaft“ schalten, damit der steigenden Bedrohung mit einer glaubwürdigen Abschreckung entgegengetreten werden kann. Hierzu sei auch die Aufhebung des Konflikts zwischen Sicherheit und Nachhaltigkeit erforderlich, da Nachhaltigkeit ohne Sicherheit keine realistische Zielsetzung wäre.