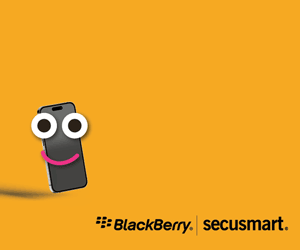Die Digitalisierung der Verwaltung kommt schleppend voran, dessen ungeachtet rückt die Frage nach digitaler Teilhabe in den Fokus: Wie lassen sich alle Bürgerinnen und Bürger in den Prozess integrieren?
Dänemark macht es vor: Seit mehreren Jahren läuft die Verwaltungsarbeit in dem 5,8-Millionen-Einwohner-Staat zu großen Teilen digitalisiert, Anträge werden automatisiert verarbeitet, Bürgerdaten untereinander ausgetauscht, so dass Verwechslungen vorgebeugt werden kann. Zum Thema Datenschutz hat ein Großteil der Bevölkerung ein entspannteres Verhältnis als dies hierzulande der Fall ist, das Vertrauen in den Staat ist allgemein groß. Fast 90 Prozent der an die Verwaltung adressierten Anträge werden mittlerweile online eingereicht.
Das liegt allerdings nicht nur am großen Vertrauen, sondern vor allem daran, dass die Dänen per Gesetz zur digitalen Erledigung von Behördengängen verpflichtet sind. Wer analog bleiben will, hat die Möglichkeit eines Opt-out. Per entsprechendem Antrag kann also auf Papier ausgewichen werden.
Doch inwiefern lässt sich das dänische Modell auf die Bundesrepublik übertragen? Und wäre eine verpflichtende Digitalisierung von Behördengängen hierzulande juristisch fundiert? Bestimmte Bevölkerungsgruppen – die beispielsweise der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind, körperliche Einschränkungen besitzen oder sich in prekärer finanzieller Lage befinden – würden so möglicherweise von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen.
Keine direkte Vergleichbarkeit
Für Esther Steverding ist das Nachbarland derzeit nur bedingt dazu geeignet, eine Vorreiterrolle für Deutschland einzunehmen. „Deutschland und Dänemark sind nicht eins zu eins miteinander vergleichbar“, sagt die Referentin Public Sector des Digitalverbands Bitkom und führt zur Begründung an: „In Dänemark gibt es kaum föderalen Strukturen, es ist alles zentralisierter: In Deutschland ist das anders. Auch haben wir in Deutschland ein ganz anderes Level der Digitalisierung. Wir können das dänische Modell rein digitaler Kommunikation mit den Behörden noch gar nicht so umsetzen.“
Denn durch die schleppende Digitalisierung und die erst kürzlich gescheiterte Annahme des OZG 2.0 im Bundesrat habe man „auf jeden Fall noch ein paar Jahre mit analogen Verwaltungsleistungen“ zu tun. Laut Bitkom nehmen bislang lediglich 14 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Verwaltungsleistungen online in Anspruch – eine Zahl, die reichlich Luft nach oben lässt.
Der eingetragene Verein Digitalcourage e.V. betrachtet verpflichtende digitale Behördengänge nach dänischem Vorbild mit einem kritischen Blick. Die Möglichkeiten des Opt-outs seien eingeschränkt, zudem gleiche das dänische Modell einer „Entmündigung“ der Bürger, führt der Verein an. Für eine Übertragung auf die Bundesrepublik sei der dänische Weg deshalb nicht geeignet.
Stattdessen wolle man das „Recht auf ein Leben ohne Digitalzwang“ etablieren. Um dieser Maxime Nachdruck zu verleihen, startete der Verein Ende Mai eine Petition, die bis dato aufgrund von unzureichenden Unterschriften noch nicht an den Bundestag übergeben wurde.
Bayern hat bereits erste Wege hin zu einer digitalen Inklusion beschritten. Seit 2019 unterstützt das Digitalministerium des Freistaats die Weiterbildung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sogenannten Digitallotsen. Diese sollen innerhalb ihrer jeweiligen Behörde die Digitalisierung vorantreiben, zudem Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das Problem des „Ausschlusses“ werde damit aber noch nicht gelöst, sagt eine Sprecherin des Vereins Digitalcourage. Schließlich gebe es vielfältige Gründe, weshalb Menschen digitale Angebote nicht nutzen wollten oder könnten. Durch Weiterbildungs- oder Unterstützungsmaßnahmen sei das Problem deshalb nicht zu lösen.
Esther Steverding von Bitkom hält die Digitallotsen für eine zeitlich befristete Lösung. „Solche Maßnahmen sind allenfalls für den Übergang sinnvoll“, erklärt sie. Denn es könne nicht das Ziel sein, auf unterstützende Kräfte zu setzen. „Das würde bedeuten: Mein Angebot ist so gestaltet, dass es nicht jeder nutzen kann.“ Genau das sei aber die falsche Herangehensweise.