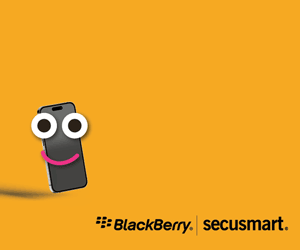Die seit dem russischen Angriff gestiegene Einsicht, dass die europäischen NATO-Bündnispartner und die EU-Mitgliedstaaten wieder mehr in ihre Verteidigungsfähigkeit investieren müssen, spiegelt sich mit einiger Verzögerung nun auch in den Auftragsbüchern der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie wider. Neben den sicherheitsund verteidigungspolitischen Aspekten kommt diesem Industriezweig aber auch unter technologischen und industriepolitischen Aspekten eine strategische Bedeutung zu, da sie neben der US-amerikanischen Rüstungsindustrie eine zentrale Rolle in der Ausrüstung und Ausstattung der europäischen Streitkräfte einnehmen.
Die Bundeswehr trägt mit ihrer Grundkonzeption als Bündnisarmee zur europäischen Sicherheitsarchitektur bei und ist fest in die Streitkräfte- und Kommandostruktur der NATO integriert. Diese tiefe europäische und transatlantische Integration hat signifikante Auswirkungen auf die Forderungslage zur operationellen und materiellen Standardisierung mit Blick auf die notwendige Interoperabilität. Nationale Individuallösungen bei der Entwicklung von Hauptwaffensystemen wären daher kontraproduktiv in Bezug auf die angestrebte materielle Interoperabilität verbündeter Streitkräfte. Zudem wären sie aufgrund der damit einhergehenden Komplexität und der Kosten für die meisten europäischen Staaten mit ihren vergleichsweise geringen Streitkräfteumfängen weder technologisch noch finanziell zu stemmen. Ebenso wie die seit Jahrzehnten bewährte zentrale Ausbildung der NATO-Kampfpiloten in den USA deren operationelle Interoperabilität gewährleistet, schaffen Kooperationen Synergien, die sich auf die angewandten Verfahren und Prozesse sowie eine möglichst gleiche technische und operationelle Ausbildung auswirken. Der gemeinsame Betrieb gleicher Waffensysteme zwischen Verbündeten im Einsatz reduziert darüber hinaus den logistischen Footprint im Einsatzgebiet. Vor diesem Hintergrund nehmen Kooperationen mit nationalen und internationalen Partnern auch für die Bundeswehr als Bündnisarmee einen besonderen Stellenwert ein.
Kooperationsmanagement durch Agenturen
Das Management für einen wesentlichen Teil der bestehenden europäischen Rüstungsprojekte erfolgt durch Agenturen, von denen die europäische Agentur OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) den größten Anteil hat. Aber auch NATO-Agenturen managen Projekte zwischen europäischen Bündnispartnern, beispielsweise die Helicopter Management Agency (NAHEMA) für den Transporthubschrauber NH- 90 oder die NATO EF 2000 and Tornado Development, Production & Logistics Management Agency (NETMA) für die Waffensysteme TORNADO und EUROFIGHTER. Diese Agenturen wurden eigens für diese Aufgabe gegründet und werden von den Mitgliedsstaaten der jeweiligen Programme finanziert. Die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ist ebenfalls überwiegend „customer funded“, vereint aber in einer einzigen Organisation Akquisition, Logistik, medizinische und infrastrukturelle Unterstützung und Dienstleistungen für Länder, Militärbehörden und Partnerländer der NATO. Dazu zählen auch das Life-Cycle-Management für mehr als 90 Waffensysteme und 170 Projekte sowie die Unterstützung der Alliierten in Einsatzgebieten. Ein besonderes Beispiel stellt die Multinational Multi-Role Tanker and Transport Fleet (MMF) dar, die Eigentum der NATO ist und von der NSPA mit Unterstützung der europäischen Agentur OCCAR koordiniert wird.
Neue Kooperationsprojekte
Am Anfang der Projektierung einer Rüstungs- oder Beschaffungskooperation steht in der Regel eine Absichtserklärung oder eine Vereinbarung zwischen den beteiligten Regierungen in Form eines Memorandum of Understanding oder Agreement, in der die wesentlichen Eckpunkte der Kooperation festgelegt werden, beispielsweise die beabsichtigte Einbindung der jeweiligen nationalen Industrien.
Aktuelle Beispiele für bereits vereinbarte Kooperationsprojekte gibt es für alle Dimensionen See, Land und Luft. So wurde 2017 ein gemeinsames Beschaffungsprogramm für ein neues Unterseeboot der Klasse U212 CD von der norwegischen und der Deutschen Marine initiiert, welches 2021 durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags genehmigt wurde. Für den Bereich der Landstreitkräfte unterzeichneten Deutschland und Frankreich 2017 eine Absichtserklärung zur Projektierung eines Main Ground Combat System (MGCS), welches im Zeitraum ab 2040-45 realisiert sein soll. 2017 gaben die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die Absicht bekannt, unter der Bezeichnung Future Combat Air System (FCAS) einen modernen Kampfjet für die französischen und deutschen Luftstreitkräfte zu entwickeln. 2019 trat Spanien diesem Projekt bei, Belgien hat ebenfalls sein Interesse signalisiert und besitzt seit 2023 eine Art Beobachterstatus.
Die Ursprünge des FCAS gehen allerdings auf eine britisch-französische Initiative aus dem Jahr 2014 zurück, aus der sich Großbritannien jedoch zurückzog und stattdessen im Jahr 2023 gemeinsam mit Italien und Japan ein Kooperationsabkommen für das Global Combat Air Programme unterzeichnete. Damit wird es absehbar nicht gelingen, ein wirklich gemeinsames Kampfflugzeugprogramm in Europa zu realisieren. Währenddessen beschaffen viele europäische Staaten Systeme aus den USA. So erfreut sich die F-35 großer Beliebtheit. In Italien, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark und dem Vereinigten Königreich nutzt man das Luftfahrzeug bereits. Auch Deutschland beschafft das Flugzeugmuster.
Amerikas Exportschlager
Dies erfolgt über das Sicherheitshilfeprogramm Foreign Military Sales (FMS). Sie erlauben den Transfer militärischer Güter und Dienstleistungen an befreundete ausländische Regierungen und bestimmte internationale Organisationen. Gerade die 1955 neu aufgestellten deutschen Streitkräfte profitierten in ihrer Aufbauphase von diesem Programm.
Während das Heer und die Marine aber bereits ab 1959 begannen, die übernommenen US-Hauptwaffensysteme durch Eigenentwicklungen zu ersetzen, nutzte die Luftwaffe weiterhin Kampfflugzeugmuster aus US-Produktion. Diese wurden erst mit der Einführung der Waffensysteme TORNADO und Eurofighter durch Kampfflugzeugmuster aus europäischen Kooperationsprojekten ersetzt. Insgesamt dominieren bei den Luftstreitkräften der europäischen NATO-Staaten jedoch nach wie vor US-Kampfflugzeuge. Hindernisse und Erfordernisse
Neue Impulse für die Dimensionen
Land, Luft und Wasser sind gesetzt, der weitere Weg zu einer funktionierenden europäischen Rüstungskooperation wird aber weiterhin nicht frei von Hindernissen und nationalen Egoismen sein. Angesichts der gegenwärtigen sicherheitspolitischen Lage und dem daraus resultierenden Streben nach einem höheren strategischen und technologischen Autarkiegrad Europas ist es aber erforderlich, diesen Weg weiter zu beschreiten. Nicht zuletzt kann über eine leistungs- und hochtechnologiefähige europäische Rüstungsindustrie den USA gezeigt werden, dass Europa und Deutschland sowohl in sicherheitspolitischer als auch in technologischer Hinsicht relevante Partner für die USA sein können. Gleichwohl liefen nicht alle europäischen Rüstungskooperationen erfolgreich. Es gibt eine Reihe von Kooperationsbeispielen, in deren Verlauf Partner bereits kurz nach Beginn oder in der laufenden Phase einer Kooperation aussteigen. Teilweise erschweren sprachliche und kulturelle Barrieren eine erfolgreiche Umsetzung von Projekten, am Ende aber gilt für künftige europäische Rüstungskooperationen, dass der Erfolg auch maßgeblich von einem Mindestgrad an (Selbst-)Disziplin und der Bereitschaft, auf nationale Sonderlösung zu verzichten, abhängt. Das gilt nicht nur für abgestimmte Fähigkeitsforderungen zu Beginn eines Rüstungsvorhabens, sondern insbesondere auch für die erforderlichen Upgrades während des Lebenszyklus eines Systems sowie für die Work-Shares, die es zwischen den Kooperationspartnern zu vereinbaren gilt. Bei den bestehenden Rüstungskooperationsprojekten gab es in diesen Bereichen viel Verbesserungspotenzial. Dass es in Zukunft absehbar nicht einfacher wird, zeigt der Versuch, eine strategische deutsch-französischitalienische Allianz im Panzerbau zu bilden, die mit der Trennung von KNDS und Leonardo aufgrund der fehlenden Einigung über die Konfiguration gerade gescheitert ist. Inwieweit dieser Bruch Auswirkungen auf die vorgesehene Beteiligung Leonardos am künftigen Main Ground Combat System haben wird, bleibt abzuwarten.