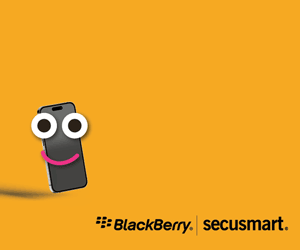Zwischen Preisdruck und Finanznot: Die Bertelsmann-Stiftung und das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) haben ihr „Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2024“ veröffentlicht. Darin wird der Investitionsstau der Kommunen deutlich.
Nach der Haushaltskrise Ende vergangenen Jahres ringt der Bund aktuell um seinen neuen Etat, auf Länderebene ist die Finanzsituation indes entspannter. „Das Haushaltsjahr 2023 ist für die Länder glimpflich verlaufen“, erklärte Dr. Matthias Woisin bei der Präsentation des neuen Jahrbuchs. So habe sich der Abstand zum Defizit des Bundes im Vergleich zum Vorjahr 2022 sogar halbiert und „werde sich weiter verringern“. Das Defizit der Länder lag 2023 bei insgesamt 1,8 Milliarden Euro, vier Bundesländer erwirtschafteten Überschüsse.
Schuldenstandquote der Länder auf Tiefstand
Eine weitere positive Nachricht: Die Schuldenstandquote der Länder ist auf einen Tiefstand gesunken. „Wenn diese Situation noch zwei weitere Jahre anhält, dann befinden sich die Schulden der Länder wieder auf Vor-Pandemie-Niveau“, prognostizierte Woisin weiter. Einzig in Hessen, Brandenburg, Sachsen und Berlin sei die Verschuldung 2023 angestiegen. „Es bleibt daher der Eindruck, dass die Länder verlässlich und stabil wirtschaften.“
Das Jahrbuch des Difu zeigt aber auch: Die finanziellen Auswirkungen der Zeitenwende sind im zweiten Halbjahr 2023 stärker zutage getreten als zuvor. Die Kosten zur Unterbringung von Geflüchteten, zur Ertüchtigung der Bundeswehr oder auch zur nötigen Erneuerung der kommunalen Infrastruktur hätten in dem Zeitraum zu Buche geschlagen, erklärte Prof. Dr. Stefan Korioth vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Universität München.
Der Investitionsrückstand auf kommunaler Ebene ist mitunter hoch, erläuterte Dr. Henrik Scheller, Teamleiter für den Bereich Infrastruktur, Wirtschaft und Finanzen am Difu. verantwortet Auch wenn sich die Finanzlage auf Länderebene verbessert – auf kommunaler Die Lücke zwischen den geplanten und verausgabten Investitionen werde immer größer, sagte er. Dabei hätten aus seiner Sicht die Investitionshemmnisse folgende Ursachen: Lieferengpässe in der Bauwirtschaft verteuerten Sanierungsprojekten, obendrauf kämen unzureichende kommunale Eigenmittel und unpassende Fördermittelangebote.
Darüber würde öffentlichen Verwaltungsgebäuden insgesamt eine niedrige Priorität eingeräumt. In Bezug auf eine energetischen Gebäudesanierung hinken die Kommunen besonders hinterher. Laut Scheller seien für die kommenden Jahre elf Milliarden Euro nötig, um Investitionsbedarfe für die Sanierung zu decken. „Dieser Rückstand bei der Sanierung wirkt sich auch auf die Wahrnehmung der Bürger von Staat und Verwaltung aus“, sagte Scheller weiter. Ebenso habe dies Einfluss auf die Produktivität der Mitarbeitenden sowie die Gewinnung von neuem Personal.
Investitionstätigkeit schrittweise erhöhen
Dr. Tom Krebs, Professor für Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Universität Mannheim, schätzt den Investitionsbedarf für die energetische Transformation der Kommunen innerhalb der nächsten zehn Jahre auf rund 200 Milliarden Euro. Die Energiekrise sei an dieser Stelle ein Treiber gewesen.
Doch am Ende lasse sich die Investitionstätigkeit der Kommunen nur schrittweise erhöhen, gab Dr. Martin Junkernheinrich vom Lehrstuhl für Stadt-, Regional- und Umweltökonomie an der RPTU Kaiserslautern zu bedenken. „Wir brauchen eine Priorisierung“, sagte er. So könne beispielsweise mit der Sanierung von Brücken nicht zehn Jahre gewartet werden, hier müsse man zeitnah beginnen. „Die kommunale Infrastruktur wurde 25 Jahre lang schleifen gelassen“, bilanzierte Junkernheinrich. „Das können wir nicht in zehn Jahren aufholen.“